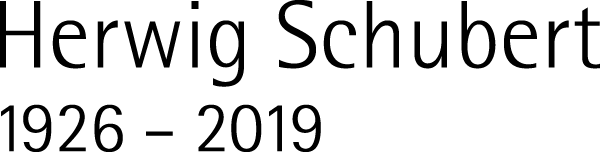Schuberts Werk
Texte und Bemerkungen zum Werk von Herwig Schubert
Monografie zur Ausstellung Herwig Schubert – Zeichnungen und Gouachen, Städtische Galerie Albstadt, 1976
Mensch und Natur
Heinrich Geissler
Schuberts Bildwelt erstreckt sich auf wenige Themen: die weibliche Aktfigur und die Landschaft. … Aktfiguren sind immer Frauen, meist einzeln, mitunter zu zweit oder in Gruppen – aber auch dann vereinzelt, ohne verbindenden Dialog. Hingeschrieben zumeist in energischen Strichen, die kaum Rücksicht auf Wohlklang der Linie oder gegenständliche Erkennbarkeit nehmen. Offenbar mehr ein Abreagieren bedrängender Bilder des Inneren, Protokolle des eigenen Zustands, als eine Wiedergabe gesehener Wirklichkeit. Bündel, Kaskaden Bleistift- oder Pinselstrichen, zerhackt wie von Hieben, Übermalungen und Korrekturen, die nicht decken, sondern die vorangegangene Form und somit den Gestaltungsprozess erkennen lassen. …, starke Weißhöhungen als dramatischer Kontrast zu den tiefen Schwärzen der Tusche aufgesetzt. Bedenkenlos, scheinbar unkontrolliert, werden die Mittel: Blei und Kreide, Deckfarbe und Farbstifte sowie mit Holzstielen (wie sonst mit der Rohrfeder)eingefügte Tuschakzente zur Erzielung des gesuchten Ausdrucks eingesetzt. Aus Wirbeln erregter Striche, wie durch Blitze erzeugtes Helldunkel, auch aus dem spannungsvollen Kontrast der verwendeten Materialien und dem Gegensatz zwischen mehr oder weniger durchgestalteten Partien verdichtet sich das Bild immer mehr, bis jener Schwebezustand erreicht ist, bei dem weitere Zufügungen den erwünschten Eindruck wieder abschwächen würden. Die psychische Geste, wild und leidenschaftlich, von starkem mitunter fast barock anmutendem Pathos (denn immer ist ja der Körper, seine Weichheit und Fülle im Spiel), das unmittelbar Persönliche und Bekenntnishafte ist wesentlicher Bestandteil dieser Darstellungen. … trotz aller Spontaneität [ist] eine Summe an bildnerischer Erfahrung nötig und bei alledem als unbewusste Kontrolle wirksam.
Schuberts Arbeitsweise ist für seine Kunstabsichten bezeichnend. Bei der Arbeit an einem Blatt breitet er weitere noch als unfertig empfundene auf dem Boden um sich herum aus, um je nach Eingebung spontan an ihnen weiterzuarbeiten. Zu dem offengelegten emphatischen Linienduktus tritt häufig noch die Farbe, treten Licht und Dunkelheiten, die den Bildraum artikulieren. Schubert ist bei aller graphischen Ausdruckskraft wesentlich Maler. Seine sparsam eingesetzten zarten Farbschleier, die pastellfarben über Leiber oder Bergflanken hinwegspielen, sind von einer fast süßen Schönheit, die verführt und verklärt. Nur ein bedeutender Maler kann mit derartig geringem Aufwand solch starke Wirkungen erreichen. Die schmelzenden Farbschleier steigern Schönheit und Sinnlichkeit der dargestellten Dinge und damit zugleich auch die Trauer, die im Wissen um ihre Vergänglichkeit liegt. … Die Erfahrung der Vergänglichkeit ist, bewusst oder unbewusst eine starke Triebfeder seiner Kunst. … im Grunde geht es immer um ein Sinnbild für menschliche Existenz in ihrer ganzen Größe und Bitterkeit.
… zu den Landschaftsbildern: Schubert sucht das Leben bewusst in seiner Gefährdung, als Wagnis zu leben, weil es ihm nur so ganzheitlich und wesenhaft erscheint. Es zieht ihn immer wieder zur starken ungezähmten Natur, auf die See oder in nördliche Regionen, nach Island, Grönland oder in den kanadischen Busch, wo sie noch in ihrer vernichtenden Übermacht, ihrer kaum zu ertragenden Größe auf Schritt und Tritt erlebbar ist. Nachträglich entstehen dann aus solchen Landschaftseindrücken große Blätter in verschiedenen Techniken …, nachträgliche Verdichtungen von Gesehenem. Mehr als äußere Einzelheiten wird dabei der „Klang“ einer Landschaft erfasst. Bei den Island-Bildern: die unendliche Weite, die großartige Eintönigkeit, Bergketten, die in mächtigem Wellenschlag eingefangen sind. Linien, die sich in der Ferne verlieren, in immer gleichem Rhythmus. Einsamkeit und Übermacht des Absoluten auch hier. Die Schönheit des Sichtbaren in farbigem Schimmer. Seelenbild und Wirklichkeit in einem. So verbindet sich dieses zweite große Thema in Schuberts heutigem Schaffen als Spiegel seiner Weltsichtmit dem ersten, mit dem ersten, den Aktzeichnungen. Er selbst hat es wohl nie als Gegensatz empfunden, denn es gibt eine Darstellung, wo er beides auf einem Blatt nebeneinander setzt: eine farbig schimmernde, machtvolle Berglandschaft und daneben, auf dem freien Rand , eine in sich selbst versunkene Mädchengestalt in fast zärtlich schmiegsamem Lineament. Man spürt etwas Gemeinsames – nicht nur in der farbigen Behandlung – und ahnt, dass die Darstellung dem Künstler – wenn auch unbewusst – zu so etwas wie einem persönlichen Sinnbild des Seins geraten ist. Gewiss, ein hohes Wort! Aber Schuberts Kunst verfügt heute in ihrer Verbindung von spontaner Gestik und kontemplativer Erfahrung über Töne, die – fernab von allen modischen Strömungen – solche dauernden Gehalte spürbar machen.
Das eigentliche Abenteuer
Margarita Jonietz
Als ein Abenteuer mit unzähligen Irrwegen umschreibt Herwig Schubert das mühevolle und konzentrierte Arbeiten an seinen Landschaftsbildern. Weit entfernt von topographischen Ansichten und Details vermögen sie die Loslösung von der gegenständlichen Welt und das Ringen, um die Kluft zu vermitteln, die zwischen dem äußeren Anlass und der eigenen inneren Erfahrung steht. Jeder Tag auf dem Weg zum Bild bedeutet für Schubert ein neues Beginnen, ein neues Überdenken und Ordnen der Erfahrung, um diese von Zweifeln getragene Distanz zu überwinden.
Für die Bildfindung entscheidend ist das unstete und ungewöhnliche Leben, welches Schubert in der Einsamkeit verlassener Landschaften sucht, um fern der Zivilisation Monate zurückgezogen die Natur als Macht und unberechenbare Größe zu erfahren. Meist in nördlichen Regionen (Kanada, Alaska oder Island) auf Flüssen im Kanu unterwegs, sammelt er seine Eindrücke, die im Tagebuch festgehalten werden. Vom Erlebnis der Natur durchdrungen, beginnt auf diesen Reisen die Landschaft seine innere Befindlichkeit zu prägen. Diese Grenzsituationen sind Anlass für die Malerei, die im Atelier den langwierigen Weg der Annäherung beginnt.
Meistens nimmt Schubert die Arbeit an drei oder mehreren nebeneinander liegenden Bildern einer landschaftlichen Gegend auf, um die zahlreichen Eindrücke und Erlebnisse nacheinander und doch im Zusammenhang auf der Fläche festhalten zu können. Das zwischen den einzelnen Bildern der Triptychen mit dem Titel „Ketchika“ oder „Fonterutoli“ entstehende und sich gegenseitig beeinflussende Gespräch wird so zum Motor der malerischen Handlung.
Schubert benötigt den Rückgriff auf die sichtbaren Dinge, um an ihnen die Dichte der Emotionen und Erinnerungen abzuarbeiten. Im Verlauf des Malvorganges, der oftmals sehr lange Zeit (bis zu zwei Jahren) einnimmt, relativiert sich das Inhaltliche der ersten gegenständlichen Fassung, während das der inneren Haltung die wesentliche Bedeutung erhält. So kann der „Schatten“ wichtiger werden als der Gegenstand, von dem er stammt. Sein Innehalten vor dem Bild, der Blick aus der Ferne und das Anschauen aus der Nähe bestimmen im wesentlichen das Auftragen der zahlreichen Malschichten in Eitempera und das überaus genaue Überarbeiten jeder kleinsten Stelle im Verhältnis zum Gesamten. Die Farbe ist so konzentriert aufgetragen, als könne durch ihre materielle Konsistenz die Natur selbst versinnbildlicht werden. Dem Betrachter ist dagegen die Suche nach einem Fixpunkt im Bild erschwert. Aus der malerischen Dichte bildet sich nur mühsam die Form vor unseren Augen und zerfällt im nächsten Augenblick, während sie sich gleichzeitig wieder neu zu bilden beginnt.
Schubert gelingt es auf diese Weise, die unterschiedlichen Erlebnisse des Menschen in der Natur allgemeingültig durch die „Gleichzeitigkeit“ des Bildes präsent werden zu lassen. Die Weite und Ferne einer landschaftlichen Gegebenheit und ihre körperliche Nähe finden ihre Analogie im Bildgefüge, das in ständiger Auflösung und Neuordnung begriffen ist. Erkennbar bleibt hierbei, dass der Prozess der Formulierung jener Verbindung von innerer Erfahrung und nach außen gerichtetem Sehen offen bleibt. Die malerische Annäherung vermag diese Kluft nicht völlig aufzuheben, so dass die Bilder zu Orten der Überprüfung und des Ringens werden. Den Arbeiten von Herwig Schubert ist ein Ausdruck von Vehemenz und Energie zu eigen, mit der der Künstler das Maß an Zerrissenheit und Anspannung zu überwinden vermag. Durch häufiges Übermalen erhält ihre Oberfläche eine unregelmäßige, raue und narbige Beschaffenheit. Ihre Kraft gewinnen die Bilder, deren Farben etwas von Erde, von Landschaften und Jahreszeiten haben, nicht zuletzt durch Risse und Brüche, vor allem aber durch die malerischen Möglichkeiten, die der Künstler bis zu den Grenzen auszuschöpfen sucht, so dass sie auf der Schwelle zwischen Harmonie und Chaos balancieren und somit das Malen als das eigentliche Abenteuer verkörpern.
Was aus sich selber und um seinetwegen beeindruckt
Reutlinger Rede auf Herwig Schubert (1991)*
Otto Breicha
Ausstellungen sind dazu da, auf einen Künstler hinzuweisen, sein Werk hervortreten zu lassen. Beides ist im Fall Herwig Schuberts angebracht. Er macht um sich kein Wesen und ist auch darum weithin so gut wie unbekannt. Weil es so ist, stellt er wenig aus. Er verweigert sich der sogenannten Szene nicht unbedingt, aber er unternimmt so gut wie nichts, um dort zu „figurieren“. Seine Malerei, charaktervoll wie sie ist, hat ihre Qualitäten anderswo.
Zunächst (in angebrachter Kürze) zur Person: Herwig Schubert wurde 1926 in Salzburg geboren. Er hat in Darmstadt und Stuttgart studiert, in Istanbul und Stuttgart unterrichtet, zwischendurch sich „freischaffend“ durchgebracht, illustriert und übersetzt. Sein Lehrfach an der Stuttgarter Akademie war das Zeichnen und Malen nach dem menschlichen Akt. Nunmehr, dem Ende seiner Stuttgarter Tätigkeit zu, ist er im Allgäu ansässig geworden, in einem ehemaligen Bauernhaus, seiner Lebensweises und Arbeit wie maßgeschneidert, abseits gelegen, wie es seiner Art entspricht, und mitten in einer Landschaft, die ihm entgegenkommt.
Er lässt sich (schon auch darum, weil er es nicht anders kann) für seine Arbeit viel Zeit. Da kann es vorkommen, dass er an Bildern jahrelang herummalt, bis er sie, halbwegs zufrieden „aus der Hand lässt“. Von „Nachfrage“ nicht gefordert und von keinen Ausstellungsterminen drangsaliert, entstehen seine Bilder langsam, aber alles in allem mit beeindruckender Konsequenz.
Herwig Schubert, der früher viel (und gut) gezeichnet hat, konzentriert sich seither (seitdem ihn die Umstände dazu befähigen) auf sein Malen. In seiner Malerei möchte er unterbringen, was ihn drängt und wozu er imstande ist. Ein komplizierter Mensch, der nicht leicht lebt, malt darum eine nicht leichtlebige quicke, sondern kompliziert verwickelte Malerei. Sie ist kompliziert ihrer Entstehungsweise (nicht ihrem Wesen) nach. Eine ganz besondere Farbigkeit und geradezu haptische Qualität sind ihre augenfälligsten Merkmale.
Malerei bedeutet für Herwig Schubert kein aufgeregtes (und dementsprechend aufregendes) Gehabe. Die Malerei, die er meint und schätzt, entsteht aus Farbe und ist in ihrer Farbigkeit begründet. Darum bewundert er Monet (mit dem ihn allerdings nicht viel verbindet). Herwig Schubert braucht die Landschaft nicht, um ihr Bilder zu entreißen. Er entwickelt (und verwickelt) das, was er sieht und erlebt, auf der Bildfläche zu etwas, das mit dem ursprünglichen Augenreiz nur mehr fern zusammenhängt. Der anfängliche Eindruck wird umständlich (und im wörtlichen Sinn!) übersetzt, vielmals verändert und „umgestaltet“, um schließlich etwas zu sein, was aus sich selber und um seinetwillen beeindruckt.
Es ist eine Malerei, ganz und gar farbig empfunden und erfunden, die ihr Wesen durch Farbe definiert. Es wäre schön (und am besten), wenn das mit einem „Wurf“ gelänge. Die Regel ist aber, dass das zunächst einmal Hingemalte immer wieder übergangen und umgemalt wird, verbessert, soweit und so gut Verbesserungen möglich sind. Es ist ein regelrechtes Abenteuer, auf das sich Herwig Schubert dabei jedes Mal wieder einlässt, ein Überraschen und Sich-Überraschenlassen von dem, was da entsteht, ein Umzweifeln des Entstandenen, ob es vielleicht nicht anders konzentrierter und eindringlicher dar- und hingestellt werden könnte. Farbschicht legt sich über Farbschicht, bis die vielen Temperahäute regelrechte Farbwülste bilden (wie sonst allenfalls beim jahrelangen Farbenprobieren auf der Palette). So sind die ungewöhnlich strukturierten Oberflächen dieser Bilder geradezu zwangsläufig so geworden, nicht von vornherein die Gestaltungsabsicht des Urhebers, sondern etwas, was im Verlauf und mit dem Werden dieser Malereien entsteht: ein Zeugnis jedenfalls auch dafür, was zuletzt (unter festverglastem Verschluss weiterem Zugriff entzogen) gar bewusst langwierig und kompliziert verwickelt in diese seine Form gebracht worden ist.
Herwig Schubert leistet es sich, seine Malerei derart umständlich zu betreiben, im Bewusstsein, dass dieses Zeithabenmüssen und Sich-Zeitlassenkönnen unabdingbare Voraussetzungen seiner Arbeit sind. Wäre es anders, wäre sie anders. So aber soll sie sein, was sie ist, weil er die Wege und Umwege , die seine Malerei herbeiführt, als das ansieht, worauf es ihm eigentlich ankommt: als ein wahrhaftig abenteuerlicher Verlauf, der alle Aufmerksamkeit und Anstrengung fordert.
Langwierigkeit und Kompliziertheit sind Eigenschaften (Charaktereigenschaften also), aber darum nicht auch schon Qualitäten, die auf alle Fälle dafürstehen. Bei Herwig Schubert verhält es sich damit etwa so, wie es auch bei Alberto Giacometti gewesen ist, der bei / mit seinem figürlichen Nachkriegswerk etwa ähnlich „gerungen“ hat. Wie man weiß, war er jeweils mit dem Geleisteten unzufrieden, bis ins Unerträgliche ausgedehnte Porträtsitzungen waren die Regel (und ein Horror der Modelle). Tags darauf wurde zerstört, was er in der Nacht zuvor modelliert hatte, die Figuren schrumpften, immer wieder überarbeitet, mitunter bis auf Stecknadelgröße. Bei Giacometti war es eine wahrhafte Wirklichkeit des Gebildeten, woran er immer wieder (und immer wieder kompliziert) scheiterte. Wenn es ihm erst nur einmal gelänge, beteuerte er, eine Nasenwurzel wirklich so zu treffen, wie sie wirklich ist, würde ihm vielleicht auch gelingen, einen Nasenflügel, eine Lippe, eine Braue, ein Auge gar zu „realisieren“.
Wären ihm seine Figuren im Lauf der Arbeit an ihnen (sozusagen aus den schaffenden Händen) nicht fortgenommen und zwischendurch abgegossen worden, gäbe es kaum eine. Seine vielen Zeichnungen, Skizzen und Studien waren Fingerübungen auf diese obsessiv vorgestellte, inständig angestrebte Wirklichkeit ihrer Erscheinungsweise zu. Wobei der Schaffensvorgang geradezu reziprok verläuft: bei Giacometti als Reduktion der Körper zu stalakmitenhaften Gebilden, bei Schubert in einem Anhäufen von Temperaschichten und Farbhäuten. Riskant, versessen und verbesserungswütig beide Male, mit sehr besonderen Schwierigkeiten und Skrupeln befasst, aber gerade deswegen interessant und faszinierend.
Es ist jedenfalls ein höchst erstaunliches Phänomen, dass gerade diese so komplex komplizierte, seismografisch fragile Art und Weise Giacomettis in aller Welt so sehr beachtet, hochgeschätzt und bewundert wird. Was in diesem Fall gilt, muss darum nicht alle Male gelten. Bei Herwig Schubert, dessen künstlerische Arbeit von ähnlichen Umständen ausgeht und betroffen ist, sollten diese jedenfalls nicht verhindern, dass seine Bilder auffallen und beeindrucken, wenn man sie, selten gewiss, aber manchmal doch (wie eben jetzt) zur Kenntnis bringt.
Wie es bei Giacometti zunächst noch in den 1950er Jahren gewesen war, ist Herwig Schuberts Malerei durchaus eine „Kunst für Künstler“. Sie wird zunächst und vor allem von kreativen oder dem Künstlerischen wenigstens nahestehenden Menschen erkannt und geschätzt, die in den Schwierigkeiten seiner Arbeit die eigenen wiedererkennen und an seinen Lösungen (die vielleicht gar keine wirklichen, aber jedenfalls versuchte, im Beispielsweisen beispielhaft sind) das Erreichte bewundern.
Es ist (wie bei Giacometti) keine Kunst aus Kalkül, nichts, was sich ausrechnen und fleißig herbeiführen lässt. Vielmehr ist es (beide Male) ein angestrengtes Improvisieren auf ein unbestimmtes Ziel hin, das (soweit als möglich) im Bild bestimmt und befestigt werden soll. Eine Kunst, die aus dem Unbewussten drängt und sich (ungewusst wie) an das Unterbewusste des Betrachters wendet; beide Male keine intellektuelle Spekulation oder Spielerei, sondern etwas, das (geradezu antiintellektualistisch, wie es ist), besser nicht zerredet wird, wie ich es, um Ihnen die Bilder hier an den Wänden näherzubringen, vielleicht schon zuviel getan habe.
*Abdruck mit Erlaubnis von Mag. Christa Breicha, Wien